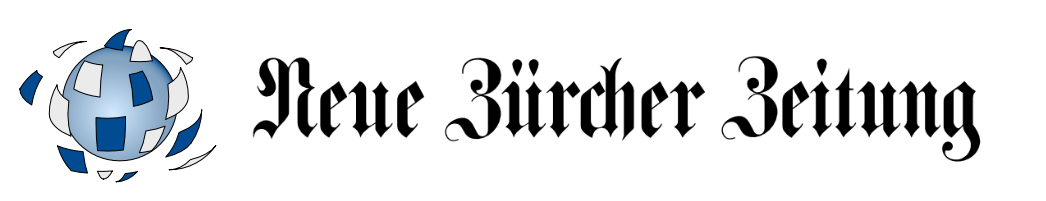Ein Essay über Armut in Zürich, inspiriert vom Film „Himmel über Zürich“ von Thomas Thümena
Sofia Vuskovic
Sie sind da.
Und doch sehen wir sie nicht.
Sie sind Teil von uns.
Und doch leben sie am Rande der Gesellschaft.
Armut in der Schweiz. Im reichen Zürich. Unvorstellbar für viele Menschen.
Nein, das sei sicher nicht so dramatisch, versuchen die meisten sich selbst zuzureden. Da übertreibe man doch nur, und wenn es Bettler gäbe, dann doch bloss ausländische, die hier sowieso nichts zu suchen hätten.
Im eindrücklichen Film „Himmel über Zürich“ von Regisseur Thomas Thümena – einem Film, in dem die Arbeit der Heilsarmee und das Leben der Aussenseiter Zürichs am Rande des Existenzminimums mit zwölf Franken pro Tag, beleuchtet werden – verkündet ein alter Herr: „Die Bettler, die hier in der Schweiz betteln und von Rumänien oder sonst irgendwo herkommen, die bekommen nichts von mir.“
Unterscheidet der Hunger zwischen Nationalitäten? Unterscheidet die Einsamkeit zwischen Nationalitäten?
Wir fragen Andreas Reinhart von der Caritas Zürich. Natürlich könne man Arme in der Schweiz nicht mit Armen in Afrika vergleichen, meint er. Aber wenn man suche, finde man immer jemanden, dem es schlechter gehe.
Armut sei relativ, bekräftigt auch der Filmemacher Thomas Thümena im Gespräch. In Afrika sei es fast einfacher, arm zu werden, als in der Schweiz. In Afrika seien alle ein wenig arm und man sei in seiner Armut nicht alleine. Hier aber zwinge sie die Leute in Isolation.
Alles Jammern auf hohem Niveau, könnte man nun meinen.
Hören wir die Betroffenen überhaupt jammern?
Hören wir sie sich beschweren?
Oder bilden wir uns nur ein sie zu hören?
Mit hochgehobenem Haupt durch das Leben zu stolzieren, ist leicht. Solange man Ohrstöpsel trägt. Solange man jemanden hat, der den Dreck von den Sohlen wegkratzt.
Eltern halten ihre Kinder fester an der Hand, wenn sie an Obdachlosen vorbeikommen, und gehen ein wenig schneller. Nur noch die kleinen Kinder schauen ihnen in die Augen. Nur noch ihre neugierigen Blicke sind nicht mit Mitgefühl oder Ekel gefüllt.
Mit Betroffenen zu sprechen werde schwierig, antwortet Reinhart auf unsere Frage.
Hat unsere Gesellschaft das Zuhören oder das Sehen verlernt? Oder gar beides?
Und warum glauben wir beurteilen zu können, was jammern ist und was nicht?
Wir, die doch alles haben. Wir, die warmes Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf haben.
Viele Fragen. Viele Möglichkeiten zu antworten. Aber keine einzige Lösung.
Nicht mal der Ansatz einer Lösung.
Es sei ein Witz, sagt Thümena. Alles in der Schweiz sei so teuer, dass auch Armutsbekämpfung wahnsinnig teuer werde. Das sei absurd und teilweise wirklich schwer begreiflich.
Ja, diesen Leute müsse man unbedingt helfen, finden an dieser Stelle einige. Aber das selbst zu finanzieren, das bitte ja nicht.
Wir glauben stets, es könne uns nicht treffen.
Wir glauben stets, nie die armen Penner auf den Bänken sein zu müssen. Und genau deshalb interessiert uns das Thema auch nicht besonders. Weil wir nicht die Protagonisten spielen.
Sollen wir uns aber wirklich erst für ein Thema interessieren, wenn wir selbst betroffen sind? Empören wir uns erst dann über soziale Ungleichheiten?
Ignoranz spaziert unsichtbar durch die Strassen. Jedenfalls so lange, bis wir die Armut nicht mehr ignorieren können. Jeder scheint ganz genau zu wissen, worüber er oder sie redet.
„Ich verstehe es ja, aber…“, glauben wir ständig bekräftigen zu müssen. Doch die Wahrheit ist, dass wir nicht wissen, wie es ist. Wir haben keine Ahnung, wie es ist, denn nur die Betroffenen verstehen es.
Es ist ausserordentlich schwer, sein Bewusstsein für die Realität zu schärfen.
Was ist eigentlich wirklich? Das, was wir in der Zeitung lesen, oder die subjektive Realität von Betroffenen?
Thümena, hat dazu eine klare Meinung: Die Stimmen derer, die wenig haben, würden immer gefiltert. Es rede stets jemand für sie, aber was sie wirklich dächten, bleibe im Verborgenen.
Er verstehe jetzt besser, wie die eigene Gesellschaft funktioniere, sagt Thümena. Endlich würde er besser verstehen, wie die Schweiz funktioniere, seitdem er gesehen habe, wie sie mit den Armen umgehe.
„Wenn man es nicht mal gesehen hat, könnte man denken, es ist ein anständiges Land, in dem alle die gleichen Chancen haben. Gleichzeitig kämpfen die Leute aber verbittert um jeden kleinsten Vorteil“. Man merke den Segen von Solidarität und warum Solidarität ein Kampf und eine Utopie bleiben würde, sagt er.
Warum braucht man in der Welt so kompetitiv zu sein? Warum fällt es so schwer anderen einen Sieg oder zumindest einen Erfolg zu gönnen? Vielleicht hat Thümena recht und Solidarität ist tatsächlich utopisch. Vielleicht ist das so weil wir Angst haben, unten zu landen. Vielleicht, weil wir uns vor nichts anderem mehr fürchten, als alleine unten zu stehen.
Deshalb behandeln wir Bettler auf den Strassen so, als gäbe es sie nicht. Deswegen schieben wir das schlechte Gewissen von uns.
„Wenn ich kaputt gehe, wen interessierts? Ehrlich, wen interessierts? Niemanden.“, sagt ein Betroffener im Film.
Im Grunde genommen sind wir nur Menschen, die vergessen haben, dass sie alle dieselbe Sprache sprechen.
Und wer kann einer Gesellschaft die Augen öffnen, wenn nicht sie selbst?